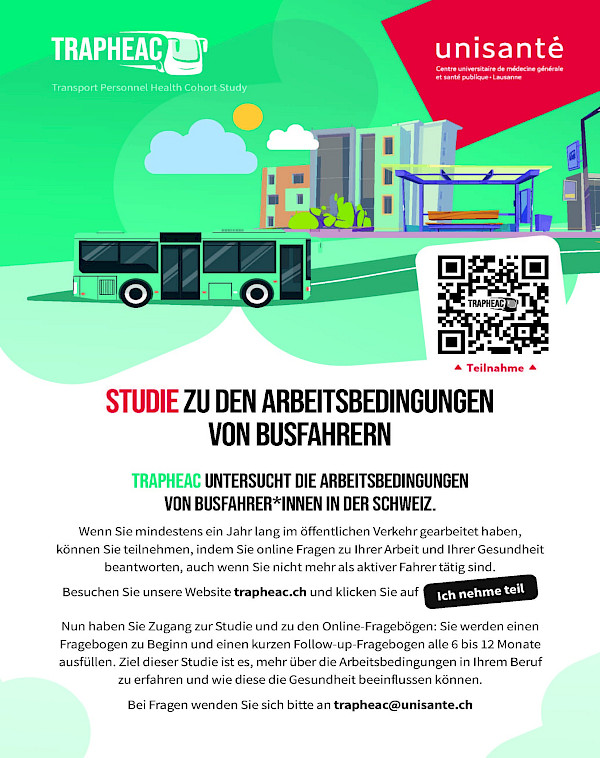Interview zum 1. Mai
«Gewerkschaften sollen Stellung beziehen»

Die rechtspopulistischen Kräfte gewinnen weltweit an Macht. Sie fordern eine Verschärfung der Asylrechte und sehen ihre Nationen bedroht durch die Einwanderung. Auch in der Schweiz wird Migration immer wieder politisch debattiert. Sozialwissenschafter Alessandro Pelizzari, Direktor der Hochschule für Soziale Arbeit und Gesundheit in Lausanne (HETSL), zeigt auf, wieso die Schweiz Migration braucht und welche Rolle die Gewerkschaft der Zukunft spielen könnte.
Alessandro Pelizzari, Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund trugen jahrelang zum Schweizer Wohlstand und Wirtschaftswachstum bei. Und sie tun es heute noch: Auch im öffentlichen Verkehr haben rund ein Drittel der Mitarbeitenden einen Migrationshintergrund. Trotzdem wird Stimmung gemacht gegen sie. Wie ordnest du das ein?
Das ist eine paradoxe Situation, aber sie ist nicht neu. Zum einen ist die Schweiz natürlich ein Einwanderungsland. Viele Branchen würden ohne ausländische Arbeitskräfte kollabieren. Aber auch ausserhalb des Arbeitsmarktes lebt die Schweiz von Migration: Unsere Kultur, unsere Gastronomie, unser Sport sind auf importierte Kompetenzen angewiesen. Das müssen wir immer wieder betonen – Migration ist etwas Positives. Und sie hat die Schweiz auch gewerkschaftspolitisch weitergebracht; durch die Migrantinnen und Migranten sind die Gewerkschaften progressiver geworden.
Aber zum anderen wird Migration politisch immer wieder instrumentalisiert, und das bewirkt gesellschaftliche Spannungen. Politisch ist auch der Wille, Arbeitsmarkt und Sozialstaat so zu organisieren, dass Menschen mit und ohne Migrationshintergrund unweigerlich in Konkurrenz zueinander treten. Lohndumping entsteht da, wo man den Arbeitgebern keine griffigen Schutzmassnahmen entgegenhält. Wichtig ist aber auch zu betonen, dass Migration nicht für Arbeitslosigkeit verantwortlich ist: In der Regel wandern Arbeitskräfte dorthin, wo sie gebraucht werden, wo also ein Fachkräftemangel besteht.
Trump will hart gegen Einwanderer vorgehen, die AfD in Deutschland möchte Menschen mit Migrationshintergrund ausschaffen. In der Schweiz hat die SVP die Volks-initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» eingereicht. Wollen die Staaten wirklich auf Migrant:innen verzichten?
Da ist viel heuchlerische Propaganda im Spiel. Grundsätzlich wissen Trump, die AfD und auch die SVP, dass der Arbeitsmarkt die Migration braucht. Aber sie wollen keine Migrant:innen, die Rechte haben. Man kann Menschen brutal ausschaffen, aber man kann Grenzen nicht schliessen. Die rechtsradikalen Parteien haben grundsätzlich nichts gegen Sans papiers, solange diese arbeiten, den Mund halten und sonst nicht auffallen.
Und wieso dann dieser raue Wind gegen Migrantinnen und Migranten?
Einerseits, weil die rechten Exponent:innen mit ihrer aggressiven Rhetorik die Migrant:innen tatsächlich verwundbarer machen, indem sie das Klima in der Gesellschaft und am Schluss auch die Politik beeinflussen. Die SVP gewinnt zwar nicht viele ihrer Initiativen, die Migrations- und vor allem die Asylpolitik hat sich aber nicht zuletzt «dank» ihr laufend verschärft. Die Einwanderungsquote wurde damit überhaupt nicht reguliert, wohl aber der Schutz der Migrant:innen umso mehr aufgeweicht. Und andererseits gelingt es den Rechten damit, die Migrant:innen zu Sündenböcken für die wirklichen Sorgen der Menschen zu machen: Sie sollen plötzlich für Kaufkraftverlust, Wohnungsnot und Sozialabbau verantwortlich sein und nicht die superreichen Steuerhinterzieher und Abzockerinnen.
Kommen wir zu den Anstellungsbedingungen. Mit der Abschaffung des Saisonnierstatuts und weiteren politischen Massnahmen wurden die Bedingungen für Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund stets verbessert. Wo stehen wir heute?
Die Einführung der Personenfreizügigkeit war tatsächlich ein Fortschritt für alle Migrantinnen und Migranten, die unter dem Saisonnierstatut litten. Denn dieses kettete sie an prekäre Arbeitsbedingungen fest, mit tieferen Löhnen und kaum sozialen Rechten. Seine Abschaffung ist übrigens auch das Werk der Migrant:innen selbst, die die Gewerkschaften in den 80er Jahren antrieben, hier endlich aktiv zu werden. Mit den flankierenden Massnahmen und dem neuen Lohnschutz machten die Gewerkschaften wichtige Schritte vorwärts. Aber wir sehen heute, dass dies nicht reicht. Der Lohndruck ist hoch, und ohne eine Stärkung der Arbeitnehmendenrechte wird es nicht gehen. Es braucht vor allem einen besseren Kündigungsschutz, der die Leute im Betrieb schützt, wenn sie sich gegen Dumpinglöhne wehren. In öffentlichen Betrieben, die der SEV organisiert, ist diese Problematik wohl weniger virulent. Aber grundsätzlich gilt: Um gegen Missbrauch zu kämpfen, braucht es starke Gesetze und starke Gewerkschaften.
Wie werden Gewerkschaften stärker?
Es braucht Gewerkschaften die fähig sind, Arbeitskämpfe zu führen, und sich nicht nur auf Gesamtarbeitsverträge (GAV) fixieren. Man darf nicht vergessen, dass die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung nicht einem GAV unterstellt ist. Für sie braucht es Anpassungen auf Gesetzesebene.
Die Gewerkschaften müssten politischer werden?
Ja, und zwar in zweierlei Hinsicht. Politisch heisst einerseits, dass sich die Gewerkschaften stärker in die Gesetzgebung einmischen müssen. Das haben sie ja auch immer wieder erfolgreich gemacht. Denken wir an die Einführung der flankierenden Massnahmen, an die kürzlich gewonnene Abstimmung zur 13. AHV-Rente oder die Mindestlöhne in verschiedenen Kantonen. Aber es gibt Themen, in denen sie sich zu bescheiden geben, wie zum Beispiel beim erwähnten Kündigungsschutz oder auch dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.
Und politisch heisst andererseits, dass sie heute angesichts des gefährlichen Rechtsrutsches klar Stellung gegen Ausgrenzung und Rassismus beziehen müssen. Gewerkschaften sind Orte der Solidarität, die Leute unterschiedlichster politischer Haltung an einen Tisch bringen und gegenseitiges Verständnis fördern können.
«Solidarität statt Hetze» lautet denn auch das diesjährige Motto des 1. Mai.
Ja, ich finde das super! Es zeigt auf, dass wir uns nur gemeinsam wehren können gegen jegliche Form von Ungleichheit und Diskriminierung.
Chantal Fischer
Alessandro Pelizzari
Alessandro Pelizzari ist Sohn von italienischen Einwanderer:innen. Der 50-Jährige hat in Soziologie doktoriert. Er war von 2008 bis 2020 als Regionalsekretär bei der Unia in Genf tätig. Seit 2020 ist er Direktor der HETSL.